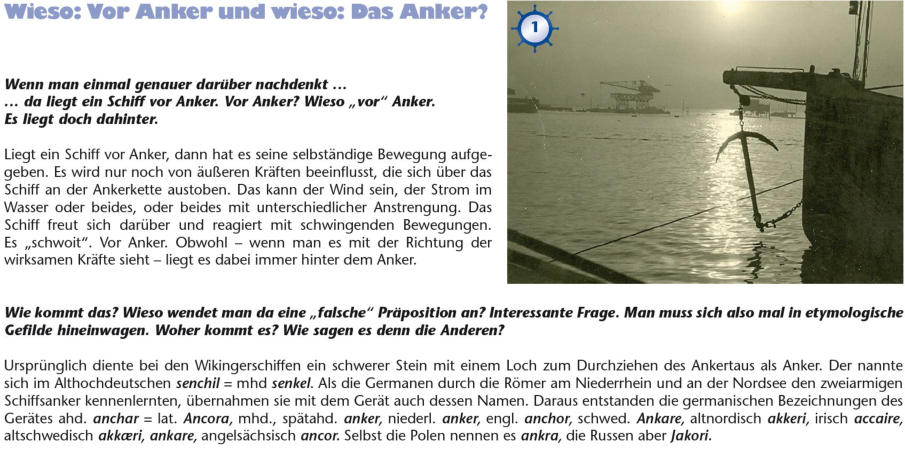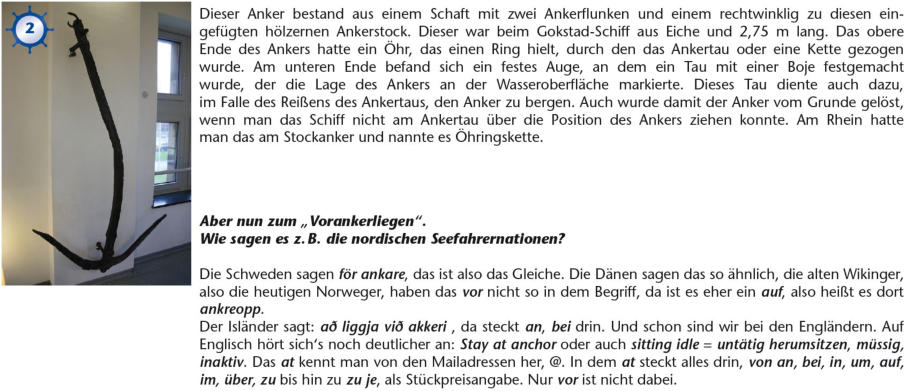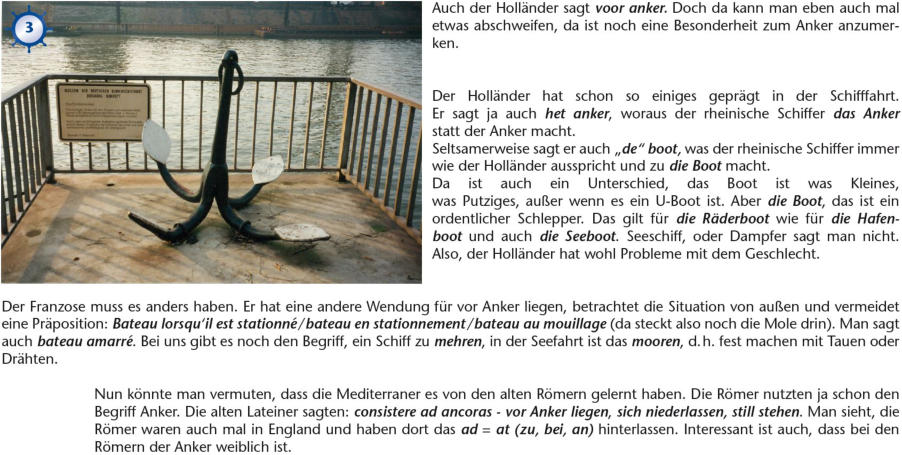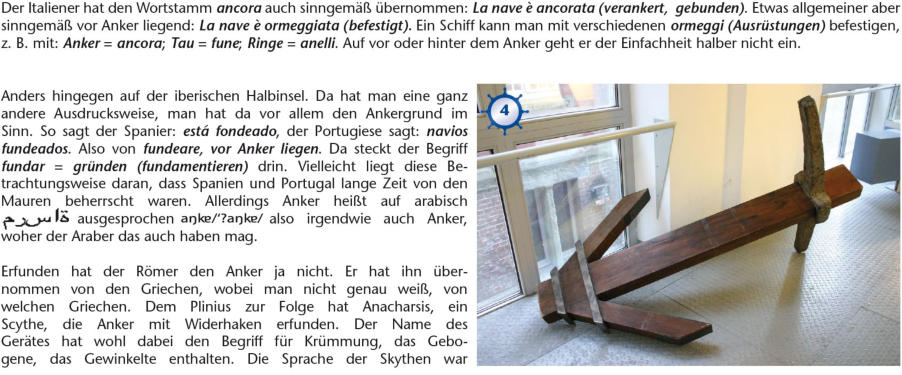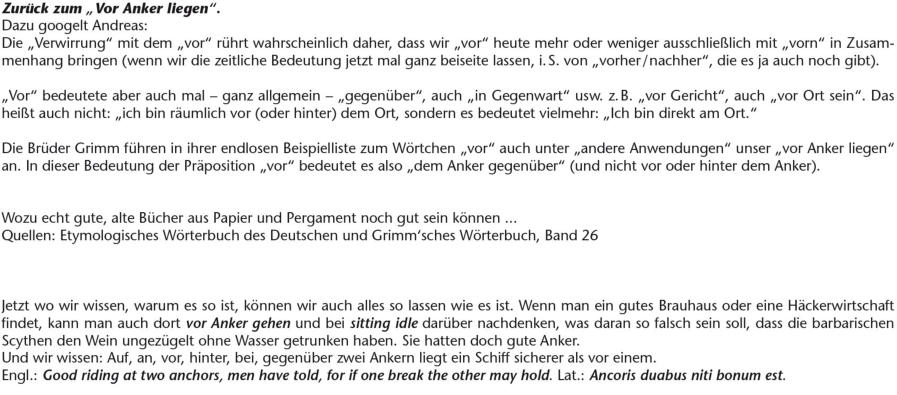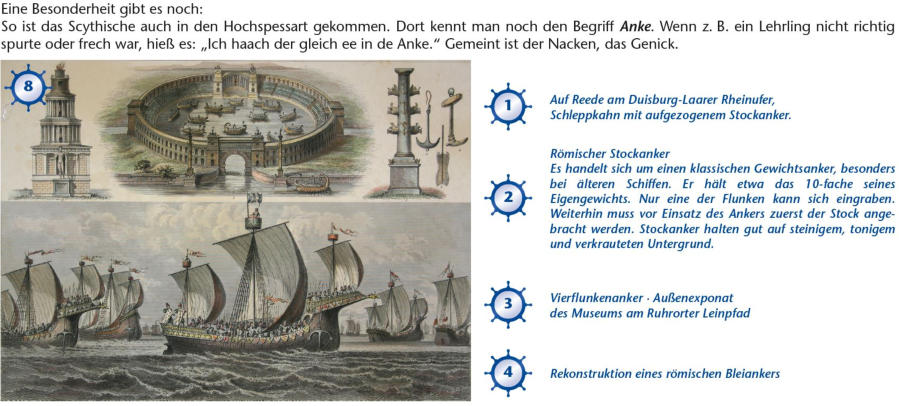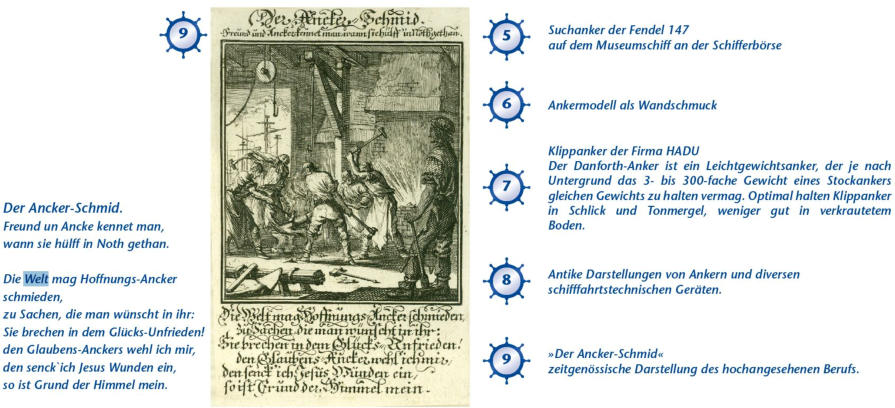© Fischer- und Schifferverein Klingenberg e.V.








Wieso: Vor Anker und wieso: Das Anker?
Wenn man einmal genauer
darüber nachdenkt ...
... da liegt ein Schiff vor
Anker. Vor Anker? Wieso
„vor" Anker. Es liegt doch
dahinter.
Liegt ein Schiff vor Anker,
dann hat es seine
selbständige Bewegung
aufgegeben. Es wird nur noch von äußeren Kräften beeinflusst, die sich
über das Schiff an der Ankerkette austoben. Das kann der Wind sein, der
Strom im Wasser oder beides, oder beides mit unterschiedlicher
Anstrengung. Das Schiff freut sich darüber und reagiert mit schwingenden
Bewegungen.
Es „schwoit". Vor Anker. Obwohl - wenn man es mit der Richtung der
wirksamen Kräfte sieht - liegt es dabei immer hinter dem Anker.
Wie kommt das? Wieso wendet man da eine „falsche" Präposition
an? Interessante Frage. Man muss sich also mal in etymologische
Gefilde hineinwagen. Woher kommt es? Wie sagen es denn die
Anderen?
Ursprünglich diente bei den Wikingerschiffen ein schwerer Stein mit einem
Loch zum Durchziehen des Ankertaus als Anker. Der nannte sich im
Althochdeutschen senchil = mhd senkel. Als die Germanen durch die
Römer am Niederrhein und an der Nordsee den zweiarmigen Schiffsanker
kennenlernten, übernahmen sie mit dem Gerät auch dessen Namen. Daraus
entstanden die germanischen Bezeichnungen des Gerätes ahd. anchar = lat.
Ancora, mhd., spätahd. anker, niederl. anker, engl. anchor, schwed.
Ankare, altnordisch akkeri, irisch accaire, altschwedisch akkceri,
ankare, angelsächsisch ancor. Selbst die Polen nennen es ankra, die
Russen aber Jakori.
Dieser Anker bestand aus einem Schaft mit
zwei Ankerflunken und einem rechtwinklig zu
diesen eingefügten hölzernen Ankerstock.
Dieser war beim Gokstad Schiff aus Eiche und
2,75 m lang. Das obere Ende des Ankers hatte
ein Ohr, das einen Ring hielt, durch den das
Ankertau oder eine Kette gezogen wurde. Am
unteren Ende befand sich ein festes Auge, an
dem ein Tau mit einer Boje festgemacht wurde,
der die Lage des Ankers an der
Wasseroberfläche markierte. Dieses Tau diente auch dazu, im Falle des
Reißens des Ankertaus, den Anker zu bergen. Auch wurde damit der Anker
vom Grunde gelöst, wenn man das Schiff nicht am Ankertau über die
Position des Ankers ziehen konnte. Am Rhein hatte man das am
Stockanker und nannte es Öhringskette.
Aber nun zum „Vorankerliegen".
Wie sagen es z.B. die nordischen Seefahrernationen?
Die Schweden sagen för ankare, das ist also das Gleiche. Die Dänen sagen
das so ähnlich, die alten Wikinger, also die heutigen Norweger, haben das
vor nicht so in dem Begriff, da ist es eher ein auf, also heißt es dort
ankreopp.
Der Isländer sagt: ad liggja vid akkeri, da steckt an, bei drin. Und schon
sind wir bei den Engländern. Auf Englisch hört sich's noch deutlicher an:
Stay at anchor oder auch sitting idle = untätig herumsitzen, müssig,
inaktiv. Das at kennt man von den Mailadressen her, @. In dem at steckt
alles drin, von an, bei, in, um, auf, im, über, zu bis hin zu zu je, als
Stückpreisangabe. Nur vor ist nicht dabei.
Auch der Hollander sagt
voor anker. Doch a kann
man eben auch mal
etwas abschweifen, da ist
noch eine Besonderheit zum
Anker anzumer-
ken.
Der Holländer hat schon so einiges geprägt in der Schifffahrt.
Er sagt ja auch het anker, woraus der rheinische Schiffer das Anker
statt der Anker macht.
Seltsamerweise sagt er auch „de" boot, was der rheinische Schiffer immer
wie der Holländer ausspricht und zu die Boot macht.
Da ist auch ein Unterschied, das Boot ist was Kleines,
was Putziges, außer wenn es ein U-Boot ist. Aber die Boot, das ist ein
ordentlicher Schlepper. Das gilt für die Räderboot wie für die Hafen-
boot und auch die Seeboot. Seeschiff, oder Dampfer sagt man nicht.
Also, der Holländer hat wohl Probleme mit dem Geschlecht.
Der Franzose muss es anders haben. Er hat eine andere Wendung für vor
Anker liegen, betrachtet die Situation von außen und vermeidet eine
Präposition: Bateau lorsqu'il est stationné / bateau en
stationnement/bateau au mouillage (da steckt also noch die Mole drin).
Man sagt auch bateau amarré. Bei uns gibt es noch den Begriff, ein Schiff
zu mehren, in der Seefahrt ist das mooren, d. h. fest machen mit Tauen
oder
Drähten.
Nun könnte man vermuten, dass die Mediterraner es von den alten
Römern gelernt haben. Die Römer nutzten ja schon den
Begriff Anker. Die alten Lateiner sagten: consistere ad ancoras - vor
Anker liegen, sich niederlassen, still stehen. Man sieht, die
Römer waren auch mal in England und haben dort das ad = at (zu, bei,
an) hinterlassen. Interessant ist auch, dass bei den Römern der Anker
weiblich ist.
Der Italiener hat den Wortstamm
ancora auch sinngemäß über-
nommen: La nave è ancorata
(verankert, gebunden). Etwas
allgemeiner abersinngemäß vor
Anker liegend: La nave
è ormeggiata (befestigt). Ein
Schiff kann man mit verschiedenen ormeggi (Ausrüstungen) befestigen,
z. B. mit: Anker = ancora; Tau = fune; Ringe = anelli. Auf vor oder
hinter dem Anker geht er der Einfachheit halber nicht ein.
Anders hingegen auf der iberischen Halbinsel. Da hat man eine ganz
andere Ausdrucksweise, man hat da vor allem den Ankergrund im
Sinn. So sagt der Spanier: está fondeado, der Portugiese sagt: navios
fundeados. Also von fundeare, vor Anker liegen. Da steckt der Begriff
fundar = gründen (fundamentieren) drin. Vielleicht liegt diese Be-
trachtungsweise daran, dass Spanien und Portugal lange Zeit von den
Mauren beherrscht waren. Allerdings Anker heißt auf arabisch
ausgesprochen anke/?anke/ also irgendwie auch Anker,
woher der Araber das auch haben mag.
Erfunden hat der Römer den Anker ja nicht. Er hat ihn übernommen von
den Griechen, wobei man nicht genau weiß, von welchen Griechen. Dem
Plinius zur Folge hat Anacharsis, ein Scythe, die Anker mit Widerhaken
erfunden. Der Name des Gerätes hat wohl dabei den Begriff für
Krümmung, das Gebogene, das Gewinkelte enthalten. Die Sprache der
Skythen war

indogermanisch. Da kann man an Anke, Angel, Haken, Nacken denken.
Auch an Anger (eigentlich Biegung, Bucht, Tal). In anderen
indogermanischen Sprachen gibt es die Wurzel ank-, ang-, = biegen,
krümmen.
Der Grieche, sagt zu vor Anker gehen/liegen: apáÇw oder aykupa (tja, wie
spricht man das aus? Aber wie man sieht, ist da Anker drin.) Die Römer
ihrerseits übernahmen den zwei- oder dreiarmigen Schiffsanker von den
Griechen und entlehnten damit die griechische
Bezeichnung ágkyra
Zurück zum „Vor Anker liegen".
Dazu googelt Andreas:
Die „Verwirrung" mit dem „vor" rührt wahrscheinlich daher, dass wir
„vor" heute mehr oder weniger ausschließlich mit „vorn" in
Zusammenhang bringen (wenn wir die zeitliche Bedeutung jetzt mal
ganz beiseite lassen, i. S. von „vorher /nachher", die es ja auch noch gibt).
„Vor" bedeutete aber auch mal - ganz allgemein - „gegenüber", auch „in
Gegenwart" usw. z.B. „vor Gericht", auch „vor Ort sein". Das heißt
auch nicht: „ich bin räumlich vor (oder hinter) dem Ort, sondern es
bedeutet vielmehr: „Ich bin direkt am Ort."
Die Brüder Grimm führen in ihrer endlosen Beispielliste zum Wörtchen
„vor" auch unter „andere Anwendungen" unser „vor Anker liegen" an.
In dieser Bedeutung der Präposition „vor" bedeutet es also „dem Anker
gegenüber" (und nicht vor oder hinter dem Anker).
Wozu echt gute, alte Bücher aus Papier und Pergament noch gut sein
können ...
Quellen: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen und Grimm'sches
Wörterbuch, Band 26
Jetzt wo wir wissen, warum es so ist, können wir auch alles so lassen wie
es ist. Wenn man ein gutes Brauhaus oder eine Häckerwirtschaft findet,
kann man auch dort vor Anker gehen und bei sitting idle darüber
nachdenken, was daran so falsch sein soll, dass die barbarischen Scythen
den Wein ungezügelt ohne Wasser getrunken haben. Sie hatten doch gute
Anker.
Und wir wissen: Auf, an, vor, hinter, bei, gegenüber zwei Ankern liegt
ein Schiff sicherer als vor einem.
Engl.: Good riding at two anchors, men have told, for if one break
the other may hold. Lat.: Ancoris duabus niti bonum est.
Eine Besonderheit gibt es noch:
So ist das Scythische auch in den Hochspessart gekommen. Dort kennt
man noch den Begriff Anke. Wenn z. B. ein Lehrling nicht richtig spurte
oder frech war, hieß es: „Ich haach der gleich ee in de Anke." Gemeint ist
der Nacken, das Genick.
Auf Reede am Duisburg-Laarer Rheinufer, Schleppkahn
mit aufgezogenem Stockanker.
Römischer Stockanker
Es handelt sich um einen klassischen Gewichtsanker,
besonders bei älteren Schiffen. Er hält etwa das 10-
fache seines Eigengewichts. Nur eine der Flunken kann
sich eingraben.
Weiterhin muss vor Einsatz des Ankers zuerst der
Stock angebracht werden. Stockanker halten gut auf
steinigem, tonigem und verkrauteten Untergrund.
Vierflunkenanker • Außenexponat
des Museums am Ruhrorter Leinpfad
Rekonstruktion eines römischen Bleiankers
Suchanker der Fendel 147
auf dem Museumschiff an der Schifferbörse
Ankermodell als Wandschmuck
Klippanker der Firma HADU
Der Danforth-Anker ist ein Leichtgewichtsanker, der je
nach Untergrund das 3- bis 300-fache Gewicht eines
Stockankers gleichen Gewichts zu halten vermag.
Optimal halten Klippanker in Schlick und Tonmergel,
weniger gut in verkrautetem
Boden.
Antike Darstellungen von Ankern und diversen
schifffahrtstechnischen Geräten.
»Der Ancker-Schmid«
zeitgenössische Darstellung des hochangesehenen
Berufs.
Freund un Ancke kennet man, wann sie hülff in Noth
gethan.
Die Welt mag Hoffnungs-Ancker
schmieden,
zu Sachen, die man wünscht in ihr:
Sie brechen in dem Glücks-Unfrieden! den Glaubens-
Anckers wehl ich mir, den senck ich Jesus Wunden ein,
so ist Grund der Himmel mein.









Text: Klaus Schmitt 2016 ® Abbildungen: ©Museum der Deutschen
Binnenschifffahrt • Apostelstraße 84 • 47119 Duisburg
Das Bildmaterial wurde freundlicherweise vom Museum der
Deutschen Binnenschifffahrt zur Verfügung gestellt.